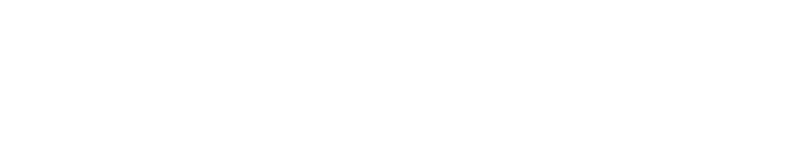... und was schreibt ein Rechtsanwalt ??
( siehe auch Cochemer Modell )
Die Rolle der Rechtsanwälte
Bernhard Theisen, Rechtsanwalt, Cochem
Vorurteile gegen Rechtsanwälte in Trennungs- und Scheidungsverfahren
Wo immer über die Rolle der am Trennungs- und Scheidungsprozess beteiligten Professionen gesprochen wird, gibt es Einigkeit nur in der Beurteilung der Anwälte: Sie sind die "Scharfmacher" und "Kriegstreiber", die in erster Linie daran interessiert sind, sich zu profilieren, möglichst viel Honorar zu vereinnahmen und die Parteien aus diesem Grunde in möglichst viele und langwierige Prozesse zu treiben. Vorurteile dieser Art wurden auch von den Vertretern der Übrigen am Scheidungsprozess beteiligten Professionen gepflegt, insbesondere den Mitarbeitern der Sozialämter und der Beratungsstellen. Und in der Tat ist nicht zu bestreiten, dass auch und gerade in Familiensachen durch beteiligte Anwälte häufig unnötige Schärfen in das Verfahren getragen werden, ohne dass für Außenstehende Grund und Anlass hierfür erkennbar ist.
Die Ursache für konfliktintensives Verhalten von Rechtsanwälten liegt vielmehr einerseits in der Struktur des Rechtsstreites, andererseits in der außergewöhnlichen Erwartungshaltung der Mandanten:
Rechtsanwälte haben selbstverständlich ein hohes Interesse daran, ihre Mandanten durch ein im Sinne ihrer Auftraggeber gutes Prozessergebnis zufrieden zu stellen, um so die Mandanten an sich zu binden, sie von der eigenen Leistungsfähigkeit zu überzeugen und gleichzeitig die eigene berufliche Reputation immer weiter zu verbessern. Aus diesem Grunde werden Anwälte stets geneigt sein, sich für die Ziele Ihrer Mandanten in besonderer Weise einzusetzen. Das liegt besonders nahe in Verfahren, die von ihrer Thematik her bei den Mandanten einen außergewöhnlich hohen Stellenwert einnehmen. Das gilt für Verfahren im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung, insbesondere jedoch für Kindschaftssachen in ganz besonderem Maße. Es kommt hinzu, dass sehr häufig die Mandanten den Anwälten gegenüber zum Ausdruck bringen, dass sie unter allen Umständen in dieser Sache obsiegen und ihren Partner als Verlierer sehen wollen. Nicht selten kündigen Eheleute sich gegenseitig an, dass der von ihnen zu beauftragende Anwalt "es dem anderen schon zeigen werde". Will der beauftragte Anwalt solchen Erwartungen gerecht werden, ist ein den Konflikt zwischen den Partnern nachhaltig vertiefender Prozess unvermeidbar.
Konfliktstrategien werden vermieden
Ziel des Arbeitskreises Trennung-Scheidung bei dem Amtsgericht Cochem ist es, diese konfliktsteigernden Mechanismen, die aus der prozessualen Struktur des Rechtsstreites erwachsen und durch die Erwartungshaltung der Mandnaten verstärkt werden, zu durchbrechen und zu einer Verfahrensweise zu gelangen, welche eine Deeskalation des Konfliktes ermöglicht.
Dieses Ziel soll auf zweierlei Weise erreicht werden:
Zum Einen soll der schriftsätzliche Vortrag an Bedeutung verlieren und der Schwerpunkt des Verfahrens auf die mündliche Verhandlung verlagert werden. Schriftsätze sollen danach nur noch die wesentlichsten Aspekte des Parteivorbringens enthalten, um das Verfahren überhaupt in Gang zu bringen. Für den Gegner soll es nicht notwendig sein, sofort und vollständig auf das jeweilige Antragsvorbringen zu erwidern. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass keine der Parteien gezwungen ist, zur Wahrung ihrer (vermeintlichen) Rechtsposition jeden auch nur möglicherweise relevanten Sachverhalt vorzutragen. Dadurch wird es insbesondere nicht notwendig, schriftsätzlich vorsorglich Sachverhalte anzusprechen, die von vornherein geeignet sind, den jeweiligen Gegner zu verletzen, in seiner Persönlichkeit anzugreifen und damit ein sich jeweils steigerndes gegenseitiges Vorbringen zu provozieren. Eine solche Verfahrensweise ist nur möglich, wenn der jeweilige Prozessgegner darauf vertrauen darf, dass ihm durch diese Verfahrensweise kein Rechtsnachteil entsteht. Aus diesem Grunde ist die Mitwirkung des Gerichtes und der auf beiden Seiten beteiligten Anwälte erforderlich.
Von mindestens ebensolcher Bedeutung ist die Vorbereitung des Verfahrens im Mandantengespräch. Dabei ist es erforderlich, mit dem Mandanten die von ihm geäußerten Wünsche kritisch zu erörtern und Verfahrensziele zu vereinbaren, die am Kindeswohl orientiert sind. Den Mandanten muss schon im Vorbereitungsgespräch klargemacht werden, mit welch erheblichen Nachteilen die Verfolgung von Konfliktstrategien verbunden ist. Insbesondere ist den Mandanten zu verdeutlichen, dass derartige Strategien in aller Regel mit dem Kindeswohl unvereinbar sind. Insbesondere muss von den beteiligten Anwälten erwartet werden, dass sie die Fragen des Kindeswohls im konkreten Fall mit den Mandanten inhaltlich erörtern und erforderlichenfalls die Verfolgung von Zielen, die mit dem Kindeswohl schlechterdings unvereinbar sind, auch zurückweisen.
Rechtsanwälte im Konflikt zwischen Mandanteninteresse und Kinderrechten?
Diese Prozessvorbereitung, die entsprechende Auswirkungen auch im Verhalten der Anwaltschaft während des Prozesses hat, beruht auf einem Rollenverständnis der Anwaltschaft, das durch die Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) vorgezeichnet ist. Danach ist der Rechtsanwalt "ein unabhängiges Organ der Rechtspflege" (§ 1 BRAO). Jeder Rechtsanwalt hat in einer öffentlichen Sitzung des Gerichtes, bei dem er zugelassen ist, folgenden Eid zu leisten:
"Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwaltes gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe." (§ 26 Abs. 1 BRAO)
Damit ist jeder Rechtsanwalt auf die verfassungsmäßige Ordnung vereidigt, was insbesondere im Kindschaftsprozess von vornherein ausschließt, die Rechte des Kindes, um das die Eltern streiten, außer Acht zu lassen. Es ist das Verdienst des Bundesverfassungsgerichtes, den am Kindschaftsprozess Beteiligten - zunächst den damit befassten Fachgerichten - in zahlreichen Entscheidungen verdeutlicht zu haben, dass Gegenstand des Kindschaftsprozesses nicht nur die Rechte der streitenden Beteiligten (Eltern oder sonstige Bezugspersonen) sind, sondern in gleicher Weise von Rechts wegen die Rechte des beteiligten Kindes zu beachten sind. Der als Parteivertreter auftretende Rechtsanwalt hat daher im Prozess diese Rechte des Kindes in gleicher Weise zu beachten wie das Gericht, weil auch der Rechtsanwalt wie das Gericht Organ der Rechtspflege ist. Damit verbietet sich jede rechtsanwaltliche Tätigkeit für eine der Prozessparteien, die sich letztlich gegen das Kindeswohl richtet. Ein solches Rollenverständnis hat Auswirkungen auf die Frage, welche Prozessziele überhaupt in Kindschaftssachen angesteuert werden und wie der Rechtsanwalt für seine Partei im Verfahren agiert. Er wird sich dort zurücknehmen, wo das Kindeswohl gefährdet ist und dort besonders einsetzen, wo das Kindeswohl dies erfordert.
Der Rechtsanwalt ist deshalb in einer schwierigen Situation, weil er - anders als das Gericht - von einer der Prozessparteien mit der Durchsetzung dieser Parteiinteressen beauftragt worden ist. Aus diesem Grunde ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass der Rechtsanwalt im Verfahren Ziele verfolgt, die dem ihm erteilten Auftrag ausdrücklich zuwider laufen. Aus diesem Grunde wird der Rechtsanwalt ständig sein Verhalten mit dem Mandanten abstimmen und dessen Zustimmung zu der gewählten Verfahrensweise einholen müssen, wenn er die Verletzung grundlegender Berufspflichten vermeiden will.
Vorteile für Verfahren und Rechtsanwälte
Die Vorteile aus diesem Rollenverständnis und dem daraus resultierenden Verhalten der Anwälte vor allem im Kindschaftsprozess liegen auf der Hand und können durch inzwischen mehr als 10-jährige Erfahrung belegt werden:
Durch die Bedeutung der mündlichen Verhandlung und die Zurückdrängung des schriftlichen Verfahrens haben die Parteien die Möglichkeit, ihre Position vor Gericht sowohl mit dem Gericht wie auch mit der Gegenseite, dem beteiligten Jugendamt und ggf. auch der Beratungsstelle an Ort und Stelle zu erörtern und den Sachverhalt von allen Seiten zu beleuchten und zu besprechen. Das hat vor allem den entscheidenden Vorteil, dass jede Partei die Gewissheit und das Gefühl hat, mit ihren Argumenten gehört und im Idealfall auch verstanden zu werden. Die Verfahrensweise verhindert ausufernden Sachvortrag, der nicht das anstehende Problem löst, sondern ausschließlich neuen Streit provoziert. Andererseits wird es möglich, auch die Hintergründe zu erörtern, die zu dem prozessualen Konflikt geführt haben. Die Erfahrung zeigt, dass auf diese Weise in aller Regel einvernehmliche Lösungen gefunden werden, die zum Einen eine gerichtliche Entscheidung überflüssig machen, zum Anderen aufwendige Folgeverfahren vermeiden, weil die Parteien im Verlaufe des Verfahrens in die Lage versetzt worden sind, künftige Meinungsverschiedenheiten entweder selbst auszutragen oder sich dazu entsprechender Hilfe zu bedienen, jedenfalls nicht ihre eigene Entscheidung durch die des Gerichtes ersetzen zu lassen.
Gruß