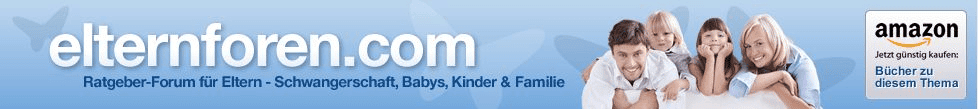Hyperaktivität bei Kindern – Therapie und Behandlung
Was ist Hyperaktivität, was ist eine hyperkinetische Störung und wann wird von ADHS gesprochen?
Hyperaktivität, ADHS und hyperkinetische Störung (HKS) sind medizinische Krankheitsbegriffe. Als Hyperaktivität wird ein überaktives Verhalten bezeichnet, das von dem Betroffenen selbst nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Die Hyperkinetische Störung (HKS), auch als Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom bezeichnet, ist eine Störung, die sich durch impulsives Verhalten, Störung der Aufmerksamkeit und häufig auch durch Hyperaktivität auszeichnet. ADHS beginnt bereits im Kindesalter, wobei die Symptome bis hinein ins Erwachsenenalter in unterschiedlicher Form fortbestehen können.
Was sind die Anzeichen für eine Aufmerksamkeitsstörung in Kindergarten und Schule?
Allgemein zeigen die Kinder folgende Symptome:
Probleme beim Stillsitzen, ungebremster Bewegungsdrang
vielfach ungezielte Bewegungen
Unruhe
Hyperaktivität
Impulsivität, können gefährliche Situationen kaum einschätzen
sprechen ständig, können nicht abwarten
sind ablenkbar
springen oft von einer Beschäftigung zur anderen und führen nichts zu Ende
hören oft nicht zu
verlieren immer wieder Dinge
wollen alles anfassen
bewegen sich unkoordiniert und hektisch
häufig gestörte Feinmotorik
unterbrechen andere in ihrem Gespräch
testen immer wieder die Grenzen aus
Kinder und Jugendliche, die an Hyperaktivität/ADHS leiden, können ausgezeichnete Leistungen in Kindergarten und Schule erbringen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt die dementsprechende Motivation haben. Da sie sich jedoch nur kurzzeitig auf eine Sache konzentrieren können, fallen ihnen Aufgabenstellungen schwer, die in einen größeren zeitlichen Rahmen fallen oder aus mehreren Einzelaufgaben bestehen. Schwierig für diese Kinder ist es auch, Informationen über eine längere Zeitspanne hinweg im Gedächtnis zu behalten. Zudem zeigt das Verhalten bei gestellten Aufgaben keine Regelmäßigkeit. Einmal werden die Aufgaben sehr gut gelöst, ein anderes Mal muss eine vergleichbare Aufgabenstellung mit mangelhaft bewertet werden. Aber nicht nur die Leistung schwankt stark. Auch die Bereitschaft, sich zu bemühen und sich anzustrengen, ist Schwankungen unterworfen. Erleben die Kinder dann noch Misserfolge, wird ihre Motivation zusätzlich gemindert, da sie nur schwer mit Frustration umgehen können.
Neben der Aufmerksamkeitsstörung haben hyperaktive Kinder meist noch weitere Störungen in verschiedenen Bereichen. Das kann sich in der Steuerung der Feinmotorik zeigen oder auch bei der akustischen oder visuellen Wahrnehmungsdifferenzierung. Bei graphomotorischen Prozessen haben diese Kinder dann häufig Schwierigkeiten.
Hyperaktive Kinder haben häufig eine besonders kreative Ader. So können sie fantastisch Geschichten erzählen, äußerst treffend Personen charakterisieren und besitzen einen speziellen Sprachwitz. Da sie jedoch in den meisten Fällen ihr eigenes Verhalten den bestehenden Situationen nicht anpassen können, kommt diese Art des Ideen- und Schöpfertums zu selten zur Geltung.
Wie wirkt sich die Störung auf das Sozialverhalten aus?
Hyperaktive und aufmerksamkeitsgestörte Kinder schließen in der Regel schnell Freundschaften. Sie überzeugen neue Freunde mit Witz und Charme und scheuen sich nicht, auf Fremde zuzugehen. So schnell, wie sie neue Freundschaften schließen, zerbrechen diese allerdings häufig auch wieder, da die Sprunghaftigkeit dieser Kinder die anderen Kinder oft verunsichert. Freundschaften zu pflegen und zu erhalten, fällt hyperaktiven und aufmerksamkeitsgestörten Kindern schwer. In vielen Fällen wirkt ihr Verhalten extrem.
Was sind die Ursachen für Hyperaktivität/Aufmerksamkeitsstörung?
Die Ursachen für diese Störung sind wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt. Es scheint sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu handeln. Forscher vermuten, dass die Gene eine wichtige Rolle dabei spielen. Diese Annahme beruht darauf, dass in vielen Fällen Eltern, Geschwister oder auch andere Verwandte an ADHS mit oder ohne Hyperaktivität leiden. Als weitere Ursache werden unter anderem Nahrungsmittelallergien diskutiert. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Alkohol, Nikotin und Drogen während der Schwangerschaft das Risiko erhöhen, an ADHS zu erkranken.
Wie häufig tritt ADHS auf?
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität ist die am häufigsten diagnostizierte psychiatrische Störung bei Kindern und Jugendlichen. Es wird geschätzt, dass etwa 3-10 % eines Jahrgangs an ADHS leiden. Nicht bei allen Betroffenen wurde allerdings eine korrekte Diagnose gestellt, d.h., sie bekommen keine angemessene Hilfe.
Was können Eltern tun, wenn sie vermuten, dass ihr Kind an ADHS leidet?
Eltern, die mutmaßen, dass ihr Kind an ADHS leidet, sollten sich zeitnah an einen Arzt ihres Vertrauens wenden. Auch wenn es immer noch Menschen gibt, die ADHS als eine sogenannte Modeerscheinung abtun, handelt es sich bei ADHS um eine ernst zu nehmende Störung. Damit den betroffenen Kindern schnell geholfen werden kann, ist es wichtig, dass eine gesicherte Diagnose gestellt wird. Zusätzlich sollten sich die Eltern umfassende Informationen über ADHS besorgen, damit sie ihre Kinder mit der Diagnose ADHS besser verstehen lernen.
Wie wird die Diagnose ADHS gestellt?
Damit geeignete Therapiemaßnahmen ergriffen werden können, muss zunächst eine korrekte Diagnose gestellt werden. Es ist empfehlenswert, dass diese Klärung im Rahmen einer differenzierten Diagnostik durch einen spezialisierten Arzt erfolgt. Er wird u.a. eine Anamnese erheben, körperliche und neurologische Diagnostik einsetzen sowie neuropsychologische Testverfahren durchführen.
Diagnose ADHS – und nun?
Nach dem heutigen Wissensstand ist eine multimodale Therapie der am meisten Erfolg versprechende Ansatz. Als Erstes werden die Eltern über das Krankheitsbild ADHS aufgeklärt, so dass sie die Situationen, in den ihre Kinder Schwierigkeiten haben, besser einschätzen können. Zusätzlich werden spezielle Lerntrainings für Eltern angeboten, in den sie sich Kenntnisse aneignen können, wie der Alltag mit einem an ADHS leidenden Kind besser zu meistern ist. Je nach Alter wird auch das Kind über ADHS aufgeklärt, so dass es lernen kann, sich und seine Fähigkeiten, aber auch die Schwierigkeiten, die ADHS mit sich bringt, einzuschätzen. Damit verbunden ist ein Verhaltenstraining. Hier können die Kinder gemeinsam mit anderen ADHS-Kindern Strategien im Umgang mit ihrer Krankheit erlernen. Hält der Arzt es für angebracht, kann zusätzlich zu diesen Maßnahmen eine medikamentöse Therapie erfolgen.
Wenn die ADHS von anderen Störungen begleitet wird, ist es wichtig, die Therapie auch auf diese abzustimmen. Wird beispielsweise eine Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln vermutet, sollte dies unbedingt abgeklärt werden.
Medikamente bei ADHS
Zur Behandlung bei ADHS wird vor allem Methylphenidat, ein Arzneimittel mit stimulierender Wirkung eingesetzt. Der Handelsname, unter dem es die meisten Menschen kennen, ist Ritalin. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und der behandelnde Arzt entscheidet, ob die Behandlung mit Ritalin angebracht ist und legt auch die notwendige Dosierung fest.
Hyperaktivität – Tipps für den Umgang mit hyperaktiven Kindern
Hyperaktive Kinder brauchen deutliche Regeln
Wenige Regeln, die konsequent befolgt werden müssen, sind bei hyperaktiven Kindern empfehlenswert. Die Regeln sollten so gestaltet sein, dass sie von den Kindern auch nachvollzogen werden können.
Klare Strukturen sind wichtig
Hyperaktive Kinder brauchen klare Strukturen, an denen sie sich orientieren können. Handelt es sich um ein komplexes Thema, wie beispielsweise das Zimmer aufräumen, sollte der gesamte Vorgang in einzelne Handlungselemente untergliedert werden. Es heißt also nicht lapidar: „Räum dein Zimmer auf.“, sondern „Stelle alle Bücher in dieses Fach auf dem Regal.“ oder „Räume alle Legosteine in deine blaue Spielzeugkiste.“
Ein geregelter Tagesablauf gehört dazu
Bei hyperaktiven Kindern ist es wichtig, dass der gesamte Tagesablauf geregelt und strukturiert abläuft. Störungen im Tagesablauf sollten, wenn möglich, vermieden werden.
Kurze Sätze sind besser als lange Schachtelsätze
Beim Sprechen mit hyperaktiven Kindern ist es besser, kurze, klare Sätze, statt vieler langer Sätze zu formulieren. Wenn Eltern mit ihrem hyperaktiven Kind sprechen, sollten sie möglichst immer Augenkontakt halten. Will man die volle Aufmerksamkeit des Kindes erreichen, ist es sinnvoll, den Körperkontakt zu suchen, So umfasst man die Hände des Kindes und spricht ganz ruhig mit ihm.
Reizüberflutung ist bei hyperaktiven Kindern zu verhindern
Eine Reizüberflutung sollte gerade bei hyperaktiven Kindern vermieden werden. Zu viele Spielsachen oder ein zu hoher Lärmpegel sind Faktoren, die möglichst ausgeschaltet werden sollten. Ideal ist es, für das hyperaktive Kind eine ruhige Ecke in der Wohnung oder einen Entspannungsraum im Haus einzurichten. So kann sich das Kind immer dorthin zurückziehen, wenn ihm etwas zu viel oder zu stressig wird.
Bewegung ist wichtig
Eltern sollten bei hyperaktiven Kindern darauf achten, dass diese genügend Bewegung bekommen. Besonders wichtig ist es für diese Kinder, dass sie sich austoben und sich viel im Freien aufhalten können.
Gezielte Förderung hyperaktiver Kinder
Ärzte, Erzieher und Selbsthilfegruppen können zum Thema gezielte Förderung beraten und unterstützen. Dabei ist es wichtig, herauszufinden, welche individuellen Förderungsmöglichkeiten dem Kind gut tun.
Nach heutigem Stand ist der Zusammenhang zwischen ADHS und der Ernährung noch nicht abschließend geklärt.
Hilfe finden
Eltern von ADHS Kindern haben häufig frustrierende Jahre hinter sich. Es ist nicht immer leicht, eine gesicherte Diagnose und die entsprechenden Therapien für ADHS Kinder zu erhalten. Eltern, die Selbsthilfegruppen suchen, Fachleute zum Thema ADHS benötigen oder sich gemeinsam mit anderen Eltern engagieren möchten, können auf der Webseite der ADHS Deutschland e.V. www.bv-ah.de wertvolle Informationen abrufen oder in einem Forum ADS.
ADHS bei Erwachsenen
Auch nach dem Kinder- und Jugendalter zeigen sich bei einigen ADHS Betroffenen noch deutliche Symptome und Folgen. Sie können sich schlecht konzentrieren und haben Probleme bei der Organisation im Alltag. Auch auf ihre Arbeit hat dies Auswirkungen. Oftmals handeln sie, ohne nachzudenken und schaffen damit häufig Chaos. Ihre Mitmenschen haben meist Probleme mit den Stimmungsschwankungen, unter denen die ADHS Betroffenen als Erwachsene leiden, denn es ist schwer abzuschätzen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren.
Ist ADHS heilbar?
Nach heutigem Wissensstand ist ADHS nicht heilbar. Betroffene können aber Strategien erlernen, wie sie mit dieser Störung umgehen und den Alltag besser meistern können. Wichtig ist es, nach einer gesicherten Diagnose frühzeitig eine gezielte Förderung in Angriff zu nehmen und sowohl ADHS als auch die Begleiterkrankungen, die auftreten können, zu behandeln. Ob Medikamente zur Behandlung von ADHS eingesetzt werden, entscheidet individuell der betreuende Arzt.
Die Diagnose Hyper- oder Hypoaktivität wird heutzutage weitaus häufiger gestellt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Zum einen liegt es darin, dass immer mehr Disziplin schon von den ganz kleinen Kindern gefordert wird, was ihnen aber bei ihrem Bewegungsdrang verständlicherweise sehr schwer fällt. Zum anderen sind es verschiedene Einflüsse, die bereits in der Schwangerschaft den Grundstein für eine gesteigerte oder geminderte Aktivität legen. Hilfe können Betroffene zum Beispiel in der Ergotherapie finden.
Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Rund drei bis neun Prozent der Kinder sind von diesem Syndrom betroffen, wobei auffällig ist, dass es häufiger Jungen als Mädchen betrifft. Zudem sind Jungen häufiger hyperaktiv-impulsiv. Beschwerden sind aber nicht nur im Kindesalter zu bemerken, sondern auch noch Erwachsene haben damit zu kämpfen.
Was sind die Ursachen?
Neuere Forschungen haben ergeben, dass die Ursache für ADHS genetisch bedingt sein kann. Häufig sind nämlich im direkten verwandtschaftlichen Umfeld ebenfalls Betroffene zu finden. So sind eineiige Zwillinge meist beide an ADHS erkrankt. Allerdings kann zwischen Kindern und Eltern ein unterschiedliches Ausmaß des Syndroms vorliegen. Experten vermuten, dass nicht nur ein einzelnes Gen an der Entstehung der Krankheit beteiligt ist.
Festgestellt wurde bei den Betroffenen eine Veränderung im Stoffwechsel des Gehirns. Scheinbar wirken die Neurotransmitter, die Überträgerstoffe, nicht exakt an den Synapsen, den Schaltstellen. Störungen der Funktion kommen vor allem in den Abschnitten des Gehirns vor, die für Aufmerksamkeit, Verarbeitung von Informationen und für die Wahrnehmung verantwortlich sind.
Hinzu kommt das Umfeld, in dem das Kind lebt. Dieses Umfeld kann bestimmte Symptome verstärken oder dazu führen, dass sich die Auswirkungen der Erbanlagen abschwächen. Festgestellt wurde auch, dass zum Beispiel Alkohol und Nikotin, aber auch Stress während der Schwangerschaft das Entstehen von ADHS begünstigen kann.
Wie zeigt sich die Erkrankung?
Einige Merkmale tauchen immer auf, dazu gehören die gestörte Konzentrationsfähigkeit, die Störung der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Informationen sowie die Störung der Speicherung von Informationen.
Andere Merkmale können auftreten, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Betroffenen feststellbar sein. Die motorische Hyperaktivität zeigt sich nicht immer, auch die Impulsivität, also das unberechenbare und nicht vorhersehbare Verhalten ist ebenfalls nicht immer vorhanden. Viele Betroffene haben eine niedrige Frustrationstoleranz und verfügen über eine mangelnde Steuerungsfähigkeit ihrer Emotionen. Einige Kinder werden zu Außenseitern oder zum Klassenclown.
Schon Säuglinge zeigen Symptome bei ADHS, wie lange Schreiphasen, scheinbar ohne Grund, das fehlende Suchen nach Körperkontakt oder der starke Bewegungsdrang.
Was kann unternommen werden?
Ist die Diagnose ADHS gestellt worden, muss mit einer Therapie begonnen werden, zumindest in den schweren Fällen. Haben Kinder und Umfeld keine Probleme mit dem Syndrom, so muss eine Therapie nicht zwangsläufig erfolgen. Das Ziel der Behandlung ist es, die Symptome in den Griff zu bekommen und so zu einer besseren sozialen Integration des Kindes beizutragen. Das Kind soll seine Ausbildung beenden können und ein stabiles Selbstwertgefühl aufbauen. Eine Heilung ist allerdings nicht möglich, die Stoffwechselvorgänge im Gehirn können nicht soweit beeinflusst werden.
Bei der Therapie werden verschiedene Möglichkeiten mit einbezogen, daher nennt sie sich auch die multimodale Therapie. Zum einen ist Aufklärung ganz wichtig, nicht nur für den Betroffenen und die Eltern, sondern für das gesamte Umfeld. Zur Therapie gehört ein Elterntraining dazu. Das Kind erfährt eine Verhaltenstherapie, in der es andere Verhaltensweisen kennen lernen und verinnerlichen soll, dabei werden auch individuelle Grenzen für das Kind festgelegt. Sinnvoll kann auch eine Psychotherapie sein, vor allem, wenn Symptome wie verschiedene Ängste oder eine Depression diagnostiziert wurden. Zusätzlich werden regelmäßige sportliche Betätigungen angestrebt. Ergänzend kann eine Behandlung mit Medikamenten durchgeführt werden, den so genannten Stimulanzien.
Informationen aus medizinischer Sicht finden Sie auf der Seite http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Haeufige_Probleme/s_1129.html.
ADS steht als Abkürzung für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, in Zusammenhang mit der Hyperaktivität ist die Erkrankung allerdings noch schwerwiegender. Allerdings ist auch Vorsicht geboten, denn nicht jedes Kind, das besonders lebhaft ist oder das Zeug dazu hat, die gesamte Schulklasse zu unterhalten, leidet an ADS. Es wird davon ausgegangen, dass es rund drei bis neun Prozent aller Kinder sind, die von ADS oder ADHS betroffen sind. Beide Begriffe werden in den meisten Fällen synonym verwendet, dabei kommen aber bei letzterer Diagnose Auffälligkeiten, wie sehr impulsives Verhalten und das typische Zappeln hinzu.
Symptome von ADS und ADS-Hyperaktivität
Es gibt Merkmale, die sind bei allen Betroffenen zu finden, wie die gestörte Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder erhaltene Informationen richtig zu verarbeiten. Es kann, muss aber nicht sein, dass eine Hyperaktivität hinzukommt. Diese zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Betroffene nicht still sitzen kann, er wird zum „Zappelphillip“. Außerdem neigen die Betroffenen dazu, schnell aus der Haut zu fahren, sie haben eine sehr niedrige Frustrationsschwelle.
Selbst bei den Kleinsten, den Säuglingen, ist eine Störung im Sinne von ADS oder ADHS schon erkennbar. Diese Kinder schreien viel und es ist kein Grund dafür erkennbar. Sie schmusen nicht gern, wie andere Babys das tun.
Ältere Kinder tun sich schwer damit, Freundschaften zu schließen. In der Schule wird das Syndrom dann richtig auffällig, wenn sie dem Unterricht nicht folgen können, weil sie sich weder konzentrieren noch sitzen bleiben können. Häufig zeigen die Kinder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, sie sind ungeschickt und sehr emotional.
In der Pubertät können Betroffene ängstlich, aggressiv oder depressiv sein. Sie leiden unter mangelndem Selbstbewusstsein und können einmal begonnene Aufgaben nur schwer zu Ende führen. Häufig suchen sie einen Ausweg mit Hilfe von Drogen oder Alkohol.
Allerdings haben Menschen mit ADS und ADHS auch positive Eigenschaften. Sie sind oftmals sehr kreativ, sind intelligent und haben viele Ideen. Sie sind hilfsbereit, haben einen starken Sinn für Gerechtigkeit und können sich für viele Dinge begeistern.
Therapie und Verlauf
Die Therapie der Erkrankung ist nicht einfach. Denn es muss eine kombinierte Behandlung aus Beratungsgesprächen mit dem Betroffenen, mit den Eltern und dem sozialen Umfeld geführt werden, es werden Logopädie und Ergotherapie durchgeführt und es wird geraden, den Betroffenen zu aktivem Sport zu animieren. Hinzu kommt in vielen Fällen eine medikamentöse Behandlung mit Psychostimulanzien.
Viele Kinder fühlen sich ohne eine Therapie in ihrer Lebensqualität beeinflusst, daher kann über ADS und ADS-Hyperaktivität nicht einfach so hinweggeblickt werden. Doch auch mit einer Behandlung sind es rund zehn Prozent der Betroffenen, die auch im Erwachsenenalter noch unter den Symptomen zu leiden haben. Teilweise kann es ausreichend sein, das Syndrom über einige Jahre hinweg zu behandeln, andere Betroffene müssen ihr Leben lang in Therapie bleiben. Das Ziel der Behandlung ist es, dass sich der Betroffene besser in seinem sozialen Umfeld einfügen kann und dass er so mehr Lebensqualität erreicht. Kinder sollen in der Lage sein, eine Ausbildung zu absolvieren und zumindest auf einem ähnlichen Ausbildungsstand wie ihre gesunden Mitschüler zu sein. Mit Hilfe der Therapie lernen die Betroffenen, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Eine spontane Änderung der Situation ist vor allem nach der Pubertät unwahrscheinlich, im Erwachsenenalter fast unmöglich.
https://www.youtube.com/watch?v=zdFSamPl9Ls